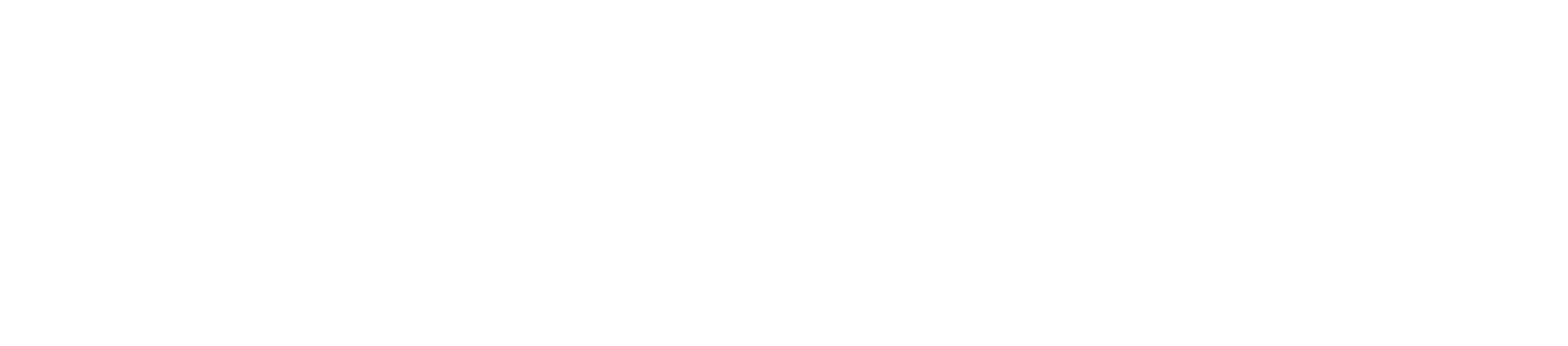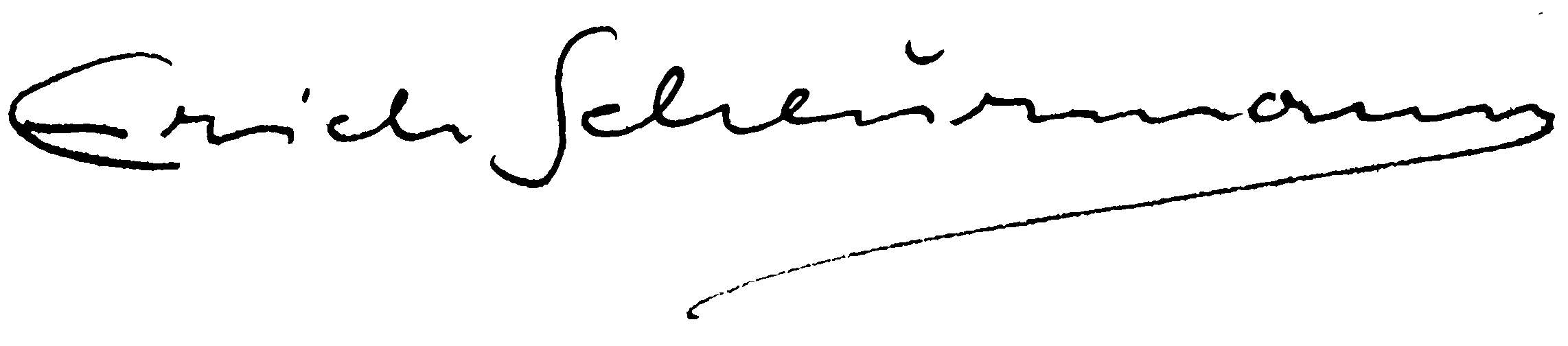In den Vereinigten Staaten
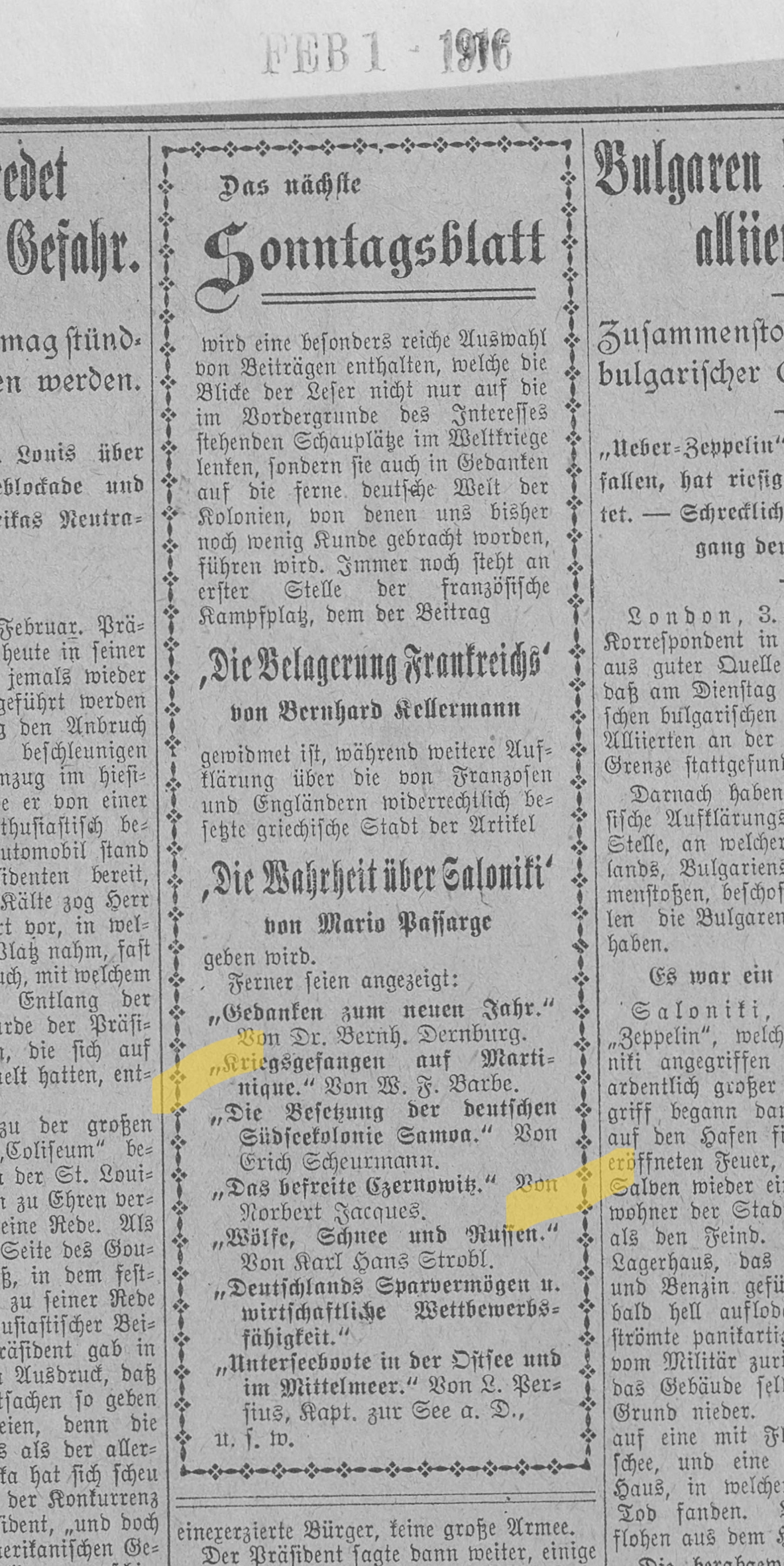
Anzeige New Yorker Sonntagsblatt
(Ausgabe vom 1. Feb. 1916 in Deutsch)
Bei der ersten Gelegenheit verließ Scheurmann im Herbst 1915 die Inseln Richtung USA in der trügerischen Hoffnung, von hier nach Deutschland weiter zu kommen. In vielen Orten der Ostküste schlug er sich mühsam als Werberedner für das Deutsche Rote Kreuz durch.
Vor Deutschstämmigen hielt er aufrüttelnde Vorträge, die die Spendenkasse kräftig füllten. Aber bereits vor dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten musste er diese Tätigkeit aufgeben.
Mittellos und ohne Hoffnung auf baldige Heimkehr litt der Naturschwärmer Qualen in der Großstadt New York, die er als „Moloch“ und als „riesenhaftes Babel“ bezeichnete. Er zog sich an den Sterling-See zurück, der im weiteren Umkreis von New York liegt, wo er noch zwei Jahre lang in äußerster Armut ein „Überlebenstraining“ absolvieren musste.
Erst 1918 durfte er mit seiner Frau Agnes, die ihm zwischenzeitlich in die USA nachgereist war, nach Deutschland heimkehren. Hier erlebte er das Kriegsende und die schwere Zeit danach mit.
„Der Papalagi“

„Ein Sprecherhäuptling“
(in: Erich Scheurmann: „Samoa – Ein Bildwerk“)
Horn in Baden 1926
Scheurmanns Hauptwerk aber, das zahlreiche Auflagen erlebte und in mehrere Sprachen übersetzt wurde, ist der 1920 erstmals erschienene „Papalagi“.
Das heißt in der Sprache der Samoaner „der weiße Herr“. Hier läßt er den fiktiven Häuptling Tuiavii aus Tiavea sprechen, der Europa bereiste und auf seine Weise durchschaut hat.
Der Insulaner hat erkannt, wie lieblos, naturfern und gottfern die Menschen im zivilisierten Europa leben, und hält Ihnen einen Spiegel vor. Die Sicht des „Wilden“, die treffenden und überraschende Vergleiche, die aus der Eingeborenen Kultur stammen, die naive, unmittelbare Sprache, in der der sonst bei Scheurmann oft auffallende Predigerton an keiner Stelle hervorbricht, und vor allem die vielen Wahrheiten, die das Buch enthält, haben dazu geführt, das der „Papalagi“ mit großer Begeisterung aufgenommen wurde.
Man kann sogar ohne Übertreibung sagen, daß es bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ein „Kultbuch“ vor allem der Jugend war. Auch später wurde es mehrfach aufgelegt und erlebte in den 1970er Jahren sehr hohe Auflagen.
Schriftstellerisches Schaffen
Zurückgekehrt an den Bodensee war er unermüdlich tätig. Es folgten zahlreiche Veröffentlichungen, bei denen er seine Erlebnisse im Südseeparadies auf unterschiedlichste Art und Weise verarbeitete.
In „Paitea und Ilse“ werden eine Insulanerin und eine deutsche Frau gegenübergestellt. „Erwachen“ heißt der bereits erwähnte Entwicklungsroman. „Adam“ ist eine Legende, die von dem Ursprung der Menschheit handelt. „Die Rückkehr ins Eine“ und das „Menschenbuch“ variieren Scheurmanns Generalthema. Er hatte geglaubt, die Rückkehr zu den Ursprüngen, in reinster Form auf Samoa gefunden zu haben.
Wie jedoch auch dieses Paradies durch die westliche Zivilisation zerstört wird, schildert er in dem Novellenband unter dem ironischen Titel „Die Lichtbringer“ Auch heute noch lesenswert und betrachtenswert ist der sehr interessante Bildband „Samoa – ein Bilderwerk“.

Erich Scheurmann am Untersee, um 1930
(© Familienarchiv)